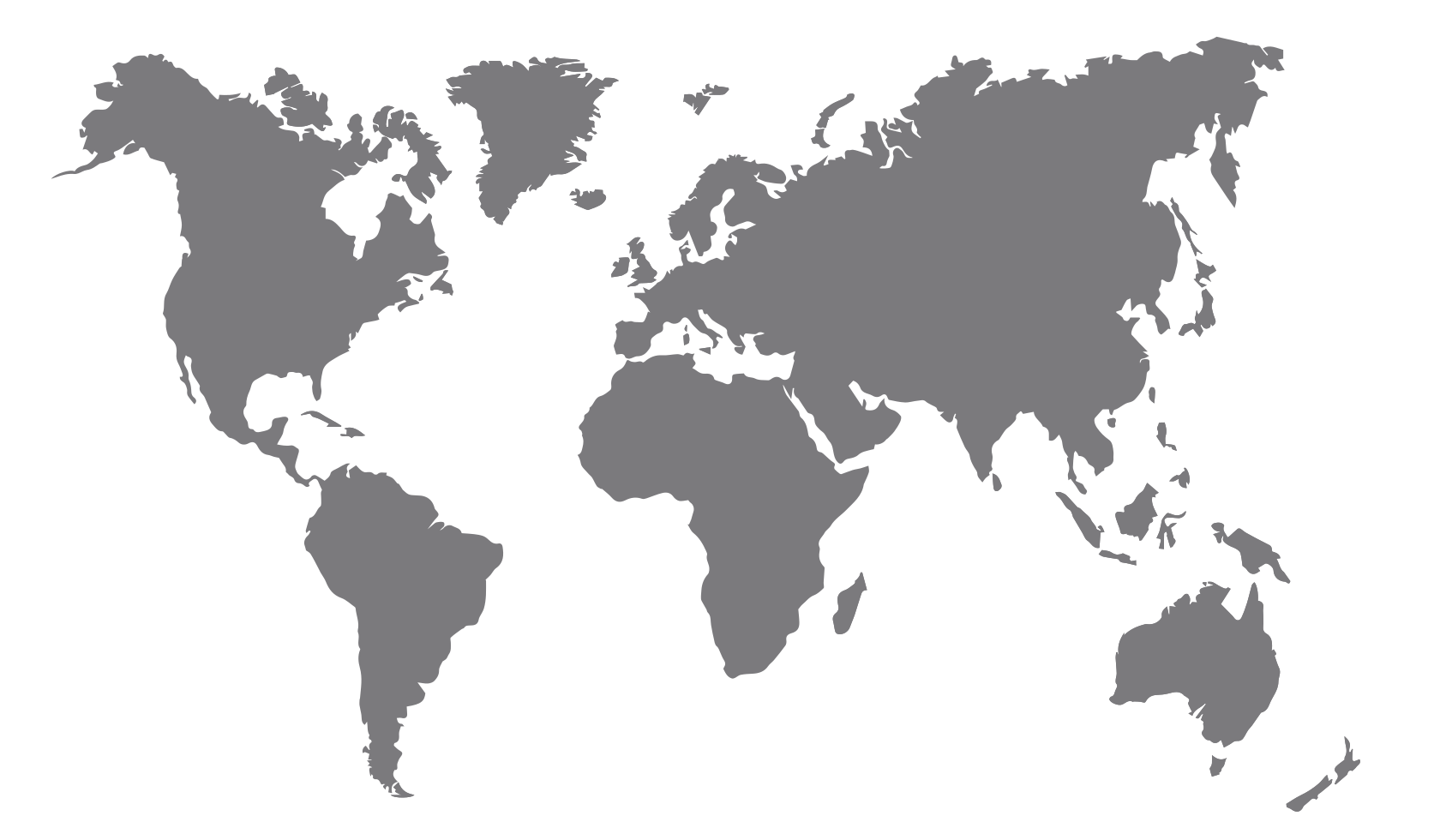Menschen Tun Dinge —
Anmerkungen zu
Wert und Wandel
von Objekten
Menschen | Tun | Dinge? Ja, wir geben zu: ein Titel, der stutzig macht. Doch bei näherer Betrachtung wird ersichtlich, dass eben diese drei Worte als Stellvertreter für den Begriff ‚Kultur‘ stehen können. Die Kultur einer Gesellschaft wird durch die Handlungen von Menschen – deren Tun – geformt. Und Dinge, die Menschen herstellen, gebrauchen oder denen sie besondere Bedeutung zumessen, gibt und gab es in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Diese Dinge sind mit zahlreichen Bedeutungen verknüpft. Forscher versuchen sie mit wissenschaftlichen Methoden zu entschlüsseln. Manche Dinge sind Fundstücke aus längst vergangenen Epochen und uns daher fremd. Andere stammen zwar aus der Gegenwart, aber sie entsprechen nicht unseren europäisch geprägten Normen und Vorstellungen – ihr Sinn oder Nutzen bleibt uns, wenigstens auf den ersten Blick, ebenfalls verborgen.
Aber jedes Ding ist ein wertvolles Zeugnis! Die Kulturwissenschaft weiß dies schon lange. Es ist jedoch nicht leicht, die mit den Objekten verbundenen Rätsel zu entziffern. Oft kommt es zu Missverständnissen. So werden den Dingen bestimmte ‚hauptsächliche‘ Funktionen oder Bedeutungen zugewiesen. Aber können wir sicher sein, dass diese Zuweisung dem Gegenstand wirklich gerecht wird? Dinge, die als Repräsentanten einer Kultur gelten könnten, bedürfen daher besonders sorgfältiger und differenzierter Betrachtung. In den letzten Jahren haben Fachleute immer neue Modelle und Konzepte entwickelt, um der Aufgabe einer angemessenen Beschreibung von Dingen gerecht zu werden. Das Materielle als Zeugnis des kulturellen Handelns hat sich dabei als vielgestaltig und wandelbar erwiesen. Viele Versuche, eine bestimmte Bedeutung eines Gegenstands oder einer Substanz als ‚universal‘ herauszustellen, erwiesen sich als unhaltbar. Die materielle Seite der Kultur ist nicht weniger komplex als jedes andere Feld, wie etwa Wort und Schrift. Die Verpflichtung, sich trotz dieser Herausforderung den Dingen zuzuwenden, beruht auch auf der Einsicht, dass sehr viele der in dieser Ausstellung betrachteten Kulturen keine anderen Dokumente hervorgebracht haben und hervorbringen, als eben die materiellen Objekte.
Menschen und Dinge beeinflussen sich wechselseitig. Man kann diese wechselseitigen Beziehungen als ein Netzwerk beschreiben, indem die Menschen als Akteure, die Dinge als ‚Aktanten‘ Knoten bilden, die durch Beziehungslinien miteinander verbunden sind. Die Metapher des Netzes ist hilfreich, um solche intensiven Wechselwirkungen zu beschreiben. Dieses Bild macht es zudem einfacher, die einseitige Fokussierung des Menschen zu überwinden, da Menschen und Dingen in einem solchen Netzwerk auf gleicher Augenhöhe einander gegenübertreten. Es handelt sich hier um das Modell eines symmetrischen Verhältnisses. Die Möglichkeiten der Aktanten, das aktuelle Handeln eines Menschen oder das Verhalten eines Objekts zu beeinflussen, sind nicht geringer als die der Akteure, die sich Objekten gegenübersehen.
Die Sphäre, in der Menschen und Dinge aufeinandertreffen, ist die Lebenswelt einer Gesellschaft. Sie besteht aus dem Zusammenspiel der Nutzung von Dingen und den damit verbundenen Handlungen der Menschen. Solche Verflechtungen von Mensch und Dingen kann man sich wie ein flexibles Gewebe vorstellen. Wenn es gut funktioniert, bildet es eine stabile Grundlage für den Fortbestand der betreffenden Gesellschaft. Wenn aber etwas nicht funktioniert, wenn Dinge fehlen, Entwicklungen stocken oder Bedeutungen verloren gehen, kann es zum Stillstand oder zum Untergang der Kultur kommen. Selbst das kleinste Objekt kann große Bedeutung für die Balance des Gesamtgefüges haben. Man denke nur an die verhängnisvollen Folgen eines nicht funktionierenden Bauteils in einem Flugzeug. Die Komplexität solcher Wirkungs- und Bedeutungszusammenhänge zwischen Dingen, aber auch zwischen Mensch und Gerät wird häufig erst dann deutlich, wenn ein Objekt nicht wie vorgesehen funktioniert. Dann ergibt sich ein Stillstand oder es kommt zu fatalen Wirkungen, wenn nicht zu Katastrophen. ‚Verflechtungen‘ von Dingen und Menschen sind ein sehr gutes Sprachbild, um das beschriebene symmetrische Verhältnis deutlich zu machen. Mehr noch als der Begriff des Netzwerkes ist die Metapher der Verflechtung zudem geeignet, um das ‚aufeinander angewiesen sein‘ offen zu legen: Netzwerke sind elastisch, der Ausfall eines Knotens muss zunächst keine Konsequenzen haben. Verflechtungen verweisen auf die Bedeutung jedes einzelnen Fadens, im Feld der materiellen Kultur mithin auf die Relevanz jedes Objektes.
Die Form der Dinge in einer Kultur ist abhängig von deren Nutzung, sowie von den bei der Herstellung zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Heute erscheint uns selbst das Unmögliche technisch realisierbar. Doch dem war nicht immer so. Techniken mussten sich erst entwickeln, Materialien zur Umsetzung gefunden oder beschafft werden. Hatte sich ein gewisser technischer Standard erst einmal durchgesetzt, dann galten Dinge, die ihm nicht entsprachen oder nach altem Muster hergestellt waren, schnell als unmodern oder wertlos. Techniken der Herstellung von Dingen sind ein Beispiel für das Ineinandergreifen der repräsentativen wie auch der normierenden Funktion. Erst wenn Techniken verfügbar sind, werden bestimmte Objekte hergestellt; wenn aber einmal ein bestimmter technischer Standard erreicht ist, so gelten all jene Dinge, die ihm nicht entsprechen, als weniger wertvoll oder gar unangemessen (Produktion und Gebrauch). Von ähnlich großer Bedeutung ist die Beobachtung der Veränderung und des Wandels von Dingen. Gerade weil materielle Dinge keine arbiträren Phänomene sind, wie zum Beispiel Worte und Sätze, können auch geringe Veränderungen die Entwicklung eines neuen Stils, einer Innovation oder einer neuen Bewertung anzeigen. Sowohl die Weitergabe einer tradierten Form und Gebrauchsweise als auch ihre graduelle Veränderung sind Indizien für Kulturwandel, auch wenn sie möglicherweise unterhalb der Schwelle eines bewussten Bruchs mit den Traditionen einer Gesellschaft liegen (Tradition und Wandel). Ein spezifischer Fall dieser Veränderung kann durch eine veränderte Beziehung zur Umwelt ausgelöst werden: Land wird zu einer knappen Ressource, urbane Lebensformen gewinnen an Bedeutung. Lebenswelten können sich ändern, wenn Umweltbedingungen es zulassen oder gar verlangen. Urbanisierung ist eine mögliche Folge der Veränderung von solchen Rahmenbedingungen, andere Nutzungsformen von Land wären eine andere Option (Landschaft und Urbanisierung).
Materielle Kultur ist aber nicht nur Ausdruck oder Anzeichen von Veränderung. Sie kann auch ein Instrument der Kontrolle und der Durchsetzung von Normen sein. Materielle Objekte, die eine solche Normierung lebhaft bezeugen, sind Siegel und Münzen sowie alle anderen Objekte, die im Kontext des Handels von Bedeutung sind. Gleichförmigkeit und Vorgabe von Form und Gewicht verweisen auf eine kontrollierende Instanz, also auf Personen, denen die Überwachung der Handelsnormen ein Anliegen ist (Wirtschaft und Verwaltung).
In jedem Themenbereich der vorliegenden Ausstellung „Menschen | Tun | Dinge“ wird eine spezifische Wechselwirkung zwischen Menschen und Dingen beschrieben. In allen Fällen geht es um symmetrische Beziehungen: Die Dinge treten als wesentliche Faktoren auf, die das zukünftige Handeln der Menschen in diesen Gesellschaften begrenzen oder ermöglichen, so wie auch die Menschen als Träger einer Kultur die gezeigten Dinge hervorbringen, sie verändern oder durch spezifische Bedeutungen ihnen besondere Kontexte zuweisen. In dieser Weise zeigt die Präsentation eine Vielzahl von Interaktionen, die durch die Arbeit der Archäologen und Ethnologen rekonstruiert wurde und damit grundlegende Einsichten in die jeweiligen Kulturen ermöglicht.
— Hans Peter Hahn
Eine Ausstellung von Annabel Bokern | Hans Peter Hahn | Fleur Kemmers und Doktorandinnen und Doktoranden des Graduiertenkollegs Wert und Äquivalent.